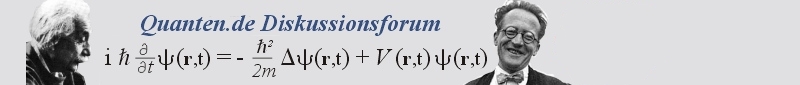
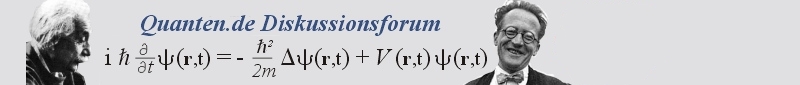 |
Die dunklen Pfade des Feynman
Superdeterminismus/ Pfadintegral - ein Thema das ich ja öfters diskutiert haben wollte.
Ein Thema das mich beschäftigt hat und wohl auch in Hossenfelders Beschreibungen des Superdeterminismus die Triebkraft ist. Sabine Hossenfelder sucht ("auch") nach Lösungen für das Messproblem im Superdeterminismus und den Pfadintegralen. Ich denke, der vermeintlich einzig offen gebliebene Ansatz. Aus den Beschreibungen der Pfadintegrale ergibt sich für mich zwangsweise eine theoretische Möglichkeit der "Absprache". Ein Objekt bewegt sich hier nicht von A nach B, sondern rein formal über viele Wege an sein Ziel. Diese Wege sind vermeintlich nicht ohne Folgen. Es sind die dunklen bzw. verborgenen Variablen. Aus meiner Sicht lassen diese, die „Welten kollabieren“ (VWI) - Die real/formal möglich wären, aber sich nicht verwirklichen. Wenn ich am Ort B „Spin up“ Messe, dann deshalb, weil die „Spin down“ Messung „kollabierte“ bzw. auf dem dunklen Pfad geraten ist. Wir können keine Informationen mit v>c erhalten, aber das Löschen hingegen? Ich hatte ja mal geschrieben, es gibt nur das was übrig bleibt. Das gilt nicht nur für das Essen vom Vortag. Keine der physikalischen Gesetzte verbietet einen „instantanen“ Kollaps der Zustände (der dunklen Welten), die wir nicht messen (werden). Das „unbemerkte/verborgene“ Löschen von Informationen unterliegt nicht der Lichtgeschwindigkeit. Erst das "Licht" (mit v=c) bringt, dann - naja ihr wisst schon - Licht ins dunkle ;) |
AW: Die dunklen Pfade des Feynman
Hallo Eyk, ich möchte an dieser Stelle eigentlich nur etwas Werbung für die ontische Interpretation der Wellenfunktion machen. Das ergibt für mich ein vergleichsweise einfaches und konsistentes Bild der mikroskopischen Welt.
Die Wellenfunktion wird dabei als reales Feld mit physikalischen Eigenschaften wie Masse, Spin, Ladung usw. angesehen. Die feynmanschen Propagatoren (Integrale) beschreiben dann lediglich, die zeitliche Entwicklung dieser Felder. Man muss hier allerdings die Bereitschaft mitbringen das alte bohrsche Atommodell ziemlich komplett zu vergessen, wo teilchenartige Wellen um einen Atomkern "kreisen". |
AW: Die dunklen Pfade des Feynman
Zitat:
|
AW: Die dunklen Pfade des Feynman
Zitat:
Ich füge dann als Einschränkung hinzu, dass sich obige Beschreibung nur auf die Darstellung der Wellenfunktion im Ortsraum bezieht. Bei den EPR-Experimenten wird die Wellenfunktion in einem anderen Zustandsraum betrachtet. |
AW: Die dunklen Pfade des Feynman
Hallo Bernhard,
habe mich nun mit verschiedenen Interpretationen / Ansätzen auseinandergesetzt und alle lassen Fragen offen (Realität/Nichtlokalität/Messproblem). Superdeterminismus lässt keine Fragen offen, außer die Frage nach dem wie. Ich vermute, dass die Abneigung gegenüber dem Superdeterminismus doch eher emotional begründet ist, als physikalisch / mathematisch. Die Befürchtung, dass QM-Effekte Einfluss auf unser Bewusstsein haben, trage ich eben nicht. Es sei denn, man entscheidet nicht „nach Bauch“ sondern nach „Spin up/down“. Wie das Morgen aussieht, kann man auch in einer Superdeterministischen QM beeinflussen – nur nicht das Spin up/ down, aber dafür kann die Natur eben nicht nach vorne schauen. Nicht zum Superdeterminismus - aber zu Interpretationen. Was von Martin Bäcker. |
AW: Die dunklen Pfade des Feynman
Zitat:
nicht unbedingt. Ich persönlich finde die Frage nach der Determiniertheit unserer Welt ganz allgemein als ziemlich uninteressant, weil es kaum vorstellbar ist, dass das auf unseren Alltag eine Auswirkung hat. Zitat:
|
AW: Die dunklen Pfade des Feynman
Zitat:
Zitat:
Wir verlassen uns jedoch nicht darauf, dass ein Photon hier oder dort erscheint. Auch die Helizität der Elektronen, hat keinen Einfluss auf das Ergebnis meiner Entscheidungen oder vermeintlich wichtiger - auf das Ergebnis 1+1 in meinem Taschenrechner… Ich verzichte mal auf den Link zu einer Tagung mit Hossenfelder in Bonn 2022, da die Qualität der Videos… Aber das Thema dort: Superdeterminismus und Retrokausalität – ist natürlich für mich erfrischend. Nicht aus dem dortigen Diskussionsthema (habe es aber auch nicht "durchgehört"), aber für mich eines – und wie immer schwer verdaubar…: Es ist schon erstaunlich, das jedes messbare Teilchen sich (retrospektiv) lokal (und wenn auch im Higgsfeld) sich mit c bewegt (hat/hatte). Ausgerechnet ein v, dass für das Fehlen von einem „dt bzw. "ds“ steht. Ein – oder eigentlich das - Extremum im „Hamiltonschen Prinzip“ bezüglich der Zeit oder der Geschwindigkeit. Ein Sammelbecken für das was existiert. Nur die Pfade zwischen A und B sind vollgespickt mit Post- und Retrokausalen Wechselwirkungen. Virtuelle Teilchen werden „später ausgesendet, aber früher eingefangen“. Von A nach B nimmt ein Teilchen offenbar nicht nur alle Pfade in x,y,z sondern vermeintlich auch in der Zeit – wir messen ein Teilchen jedoch nur da, wo sich diese Pfade zu t=0, bzw. v=c aufsummieren. E/p = c entspricht. Teilchen für die als Lösung E/p ungleich c ergibt, fließen nur zwischen A und B in die Formel (in die Realität) ein und bestimmen den Erscheinungsort. Können sich jedoch selbst nicht verwirklichen. Teilchen E/p ungeleich c passen einfach nicht in die Gegenwart, in das "Jetzt" - dem fehlenden dt. Sie "realisieren" sich offenaber nur in "Zukunft" und "Vergangenheit". Prägen aber so das "neue Jetzt". Zeit als imaginäre Größe der imaginären Teilchen. Warum nicht Annehmen, dass der „neue“ Ort B, dem Ort entspricht, auf dem das Teilchen in der Summe seiner Pfade durch Raum und Zeit weder ein „dt“ noch ein „ds“ erfahren hat, da/weil es sich mit c bewegt hat. |
AW: Die dunklen Pfade des Feynman
Zum Thema passend: https://www.derstandard.at/story/200...taet-aufraeumt
|
AW: Die dunklen Pfade des Feynman
Zitat:
Was spricht dafür sie ontisch zu betrachten? |
AW: Die dunklen Pfade des Feynman
Zitat:
EDIT: A. Zeilingers Experimente zur Verschränkung zeigen ebenfalls, dass man sich Elektronen besser nicht als klassische Punktteilchen vorstellen sollte, weil ja sonst die bellsche Ungleichung verletzt werden würde. Nicht umsonst hat die Wellenfunktion ihre Bezeichnung als Wellenfunktion und zuletzt gibt es da auch noch die deBroglie-Beziehungen. Alles gute Gründe mMn für eine ontische Deutung der Wellenfunktion als echtes physikalisches Feld. Das mittlerweile historische Argument eines strahlenden, geladenen Punktteilchens im Atom kann ebenfalls mit "ruhenden" Orbitalen effektiv entkräftet werden. |
AW: Die dunklen Pfade des Feynman
Zitat:
|
AW: Die dunklen Pfade des Feynman
Zitat:
|
AW: Die dunklen Pfade des Feynman
Zitat:
Könnte man die Frage, ob die Wellenfunktion tatsächlich ein "echtes physikalisches Feld" ist eindeutig mit ja beantworten, wäre der Fall wohl klar. Doch ich finde das nicht. Hier folgert Christensen "... Thus a state in quantum field theory is drastically different from a wave function in quantum mechanics." Hast du hierzu eine Referenz? Das Doppelspaltexperiment funktioniert mit ganz unterschiedlichen Quantenobjekten bis hin hin zu C70. Willst du sagen, dass die Superposition linker Spalt + rechter Spalt nur mit ontischer Interpretation Sinn macht? Ich finde das interessant, weshalb? |
AW: Die dunklen Pfade des Feynman
Hallo Timm,
Zitat:
Zitat:
Ich hatte oben bereits eine Differenzierung der physikalischen Interpretation von Zuständen in Abhängigkeit vom Darstellungsraum angeregt und der Fockraum der bekannten Quantenfeldtheorien ist ja ebenfalls ein ganz eigener Darstellungsraum. Die zugehörige Darstellung wird auch Besetzungszahldarstellung genannt. Mich persönlich wundert es nun überhaupt nicht, dass ausgerechnet dieser Darstellungsraum von Christensen entsprechend drastisch erwähnt wird. Superpositionen von Zuständen im Fockraum ordnen ja der Existenz eines "Teilchens" in einem gewissen Zustand eine gewisse Wahrscheinlichkeit zu und da kann man nun explizit nachfragen, ob es für eine Teilchenerzeugung oder Vernichtung nicht tieferliegende Gesetze gibt, die über den Rahmen der QM hinausgehen. Zitat:
Neben der Interferenz physikalischer Felder käme als Erklärung für die Interferenz alternativ AFAIK nur noch das bohmsche Führungsfeld in Frage. |
AW: Die dunklen Pfade des Feynman
Hallo Bernhard,
Zitat:
Ich verstehe besagte Aussage so, dass sie der Vorstellung widerspricht, die Wellenfunktion könne als reales Feld betrachtet werden (dein Punkt). Für ontisch spricht, finde ich zumindest, dass das Teilchen in irgendeiner Form vor der Messung existieren muss, obwohl ihm weder Pfad noch Ort zugeordnet werden kann. Aber ich sehe nicht, dass dieses "ontisch" sich zwingend auf die Wellenfunktion bezieht. In Kurzform, das Teilchen existiert und die Wellenfunktion macht probabilistische Aussagen darüber. Aus dem, was du zum Doppelspaltexperiment schreibst, erkenne ich nicht, woraus du schließt, dass die Wellenfunktion ontisch ist. Sicher gibt es "kausale/reale Ursachen". Aber die gibt es doch für beliebige physikalische Phänomene. |
AW: Die dunklen Pfade des Feynman
Zitat:
Das Muster kann doch nur entstehen, wenn es ein Führungsfeld für das einzelne Elektron gibt oder wenn es nahezu gleichzeitig durch beide Spalte geht. Läßt man das bohmsche Führungsfeld mal außer acht, bleibt nur letztere Möglichkeit. Wie aber kann ein einzelnes lokalisiertes Teilchen gleichzeitig an zwei Orten sein? Welchen Sinn macht es Wahrscheinlickeiten für verschiedene Wege aufzusummieren? Wie kann die Wahrscheinlickeit für ein bestimmtes Ereignis die Wahrscheinlichkeit für ein anderes davon unabhängiges Ereignis beeinflussen? Das sind doch alles (logische) Widersprüche, der sich auch mit einer extrem schnellen Zitterbewegung nicht auflösen lassen? |
AW: Die dunklen Pfade des Feynman
Zitat:
Ich tue mir schwer, die Wellenfunktion, die ein mathematisches Konstrukt ist, als "Ding" zu verstehen. Aber wir bewegen uns hier im Nebel der Interpretationen der Quantenmechanik und ich wünsche dir gute Sicht, deine muss mit meiner nicht übereinstimmen. |
AW: Die dunklen Pfade des Feynman
Zitat:
Die Messung stellt nochmal ein Problem für sich dar. Als Naturwissenschaftler muss man sich freilich an die empirischen Fakten halten, was sich in Experimenten zeigt. Was man da über Teilchen weiss, ist, dass sie in Messungen immer Teilchen sind. Aber wie Heisenberg und die Kopenhagener schon wussten, erfordert eine solche "positivistische" Vorstellung, dass die Kinematik solcher Teilchen nicht mehr klassisch sein kann, es gibt da eine Unbestimmtheit. Ein Teilchen folgt nicht mehr einer klassischen Trägheitsbahn, ja, solche Bahnen sind mit der Teilchenvorstellung unvereinbar. Natürlich reicht das noch nicht, um den Doppelspalt zu erklären. Denn dazu müsste das Teilchen beim Durchgang durch einen Spalt "wissen", ob der andere Spalt geöffnet oder geschlossen wäre. Diese "Information" wäre aber durchaus ontisch. Die Frage ist nun, ob die Schrödinger-Gleichung solche "ontischen Informationen" liefern kann!? In der Beschreibung von Interferenz tut sie es zumindestens. Insofern ist sie auch ontisch, wenn auch auch (für uns) nicht direkt deutbar. Da aber für Naturwissenschaftler entscheidend ist, was sie messen, spielt hier dann noch die Messung rein. Denn bis zur Messung hat man so nur eine Überlagerung von Möglichkeiten und Wahrscheinlichkeiten. Die Frage ist nun, welche Rolle da Umgebung, Messapparat oder gar Beobachter spielen.. |
AW: Die dunklen Pfade des Feynman
Zitat:
|
AW: Die dunklen Pfade des Feynman
Zitat:
|
AW: Die dunklen Pfade des Feynman
Zitat:
Zitat:
|
AW: Die dunklen Pfade des Feynman
Kann man die nicht-Lokalität nicht damit in Einklang bringen, wenn "die eine" Wellenfunktion als global (Universum inkl. Umgebung) angesehen wird und die Quantenobjekte als Informationen (Moden?) in dieser enthalten sind?
Schon alleine der Umstand, dass der Spalt passend zur Wellenlänge des Quantenobjekts konstruiert sein muss, spricht m.E. für eine reale, also physikalische "Wellen-Entität". Die mathematische Funktion dahinter ist das Modell, also das passende Mittel zur Beschreibung der Messergebnisse. Die Sinusfunktion einer 50Hz Wechselspannung stellt ja selbst auch keine Entität dar. |
AW: Die dunklen Pfade des Feynman
Ich verstehe die Diskussion über die Frage eines Punktteilchens und der einer Wellenfunktion nicht wirklich.
Ich kenne diesbezüglich aktuell keine bessere Beschreibung als die in diesem Video, What is the Heisenberg Uncertainty Principle? A wave packet approach auch wenn es lang ist und für einige von euch eine Wiederholung ist, so sind einige Aspekte hier sehr schön dargestellt. Das geht aus dem Titel nicht unbedingt hervor. Ich kann nur empfehlen, sich das Video anzusehen, auch wenn das eine oder andere einem schon bekannt ist. Das Teilchen als Superposition von „n-Gaußwellen“… Aus meiner Sicht, ist nimmt jede dieser Wellen einen Pfad, da diese auch unterschiedlich schnell sind….Am Ort B bilden sie wieder eine Überlagerung zu einem Teilchen…Ich weiß, das trifft noch nicht den Formalismus des Pfadintegrals… BTW: Die Schwarzschild Lösung ist kein Ding aber, das was sie beschriebt schon. Und wenn eine Formel etwas allumfänglich beschreibt – so sollte sie sich nicht mehr von dem was sie beschreibt unterscheiden. EDIT: Der Ort eines freien Teilchens A "verschmiert" mit der Zeit, während der Impuls hingegen immer schärfer wird. Dasselbe gilt für Zeit und Energie. Das bedeutet das Teilchen kann oder muss sich förmlich in der Raumzeit auflösen, damit E/p ausreichend eindeutig wird. Während bei einer Wechselwirkung durch „E/p“ wieder ein völlig neues Teilchen A‘ am Ort x zu to entsteht, wobei E/p gleichzeitig verschwinden / unscharf werden. Hoffe die Beschreibung ist nicht zu kurz – ergibt sich aber aus der Darstellung im Video, eines freien Teilchens- finde ich. Es ist, als würde man an eine Feder (Teilchen) an zwei Schnüren ziehen bis die Feder flach wie die Schnur selbst ist. Dann sind Impuls und Energie doch max. scharf. Nun entsteht durch eine Wechselwirkung eine neue Störung und es entsteht eine neue Feder… So oder so ähnlich natürlich |
AW: Die dunklen Pfade des Feynman
Zitat:
Das Doppelspaltexperiment bzw. die Interferenz erscheint ja erst aufgrund der Unschärferelation. https://de.wikipedia.org/wiki/Heisen...ultane_Messung Aus meiner Sicht spielt die Unschärfe wirklich eine wesentliche Rolle, nur denke ich dabei nicht an Pfade. Ganz im allgemeinen ist der Makrokosmos ohne Wellen kaum vorstellbar. Ich finde es naheliegend bekannte Konzepte der Natur zu nutzen, denn sie funktioniert auch, wenn wir sie nicht verstehen. |
AW: Die dunklen Pfade des Feynman
Ich meine die Schrödingergleichung beschreibt das ausgehende Teilchen perfekt. Wenn es aber auf dem Weg „in Wahrheit“ verschwindet sich auflöst und stattdessen ein neues Teilchen am Ort x entsteht und mit z.B. Spin up „geboren“ wird, dann könnte der Spin down Impuls beim anderen Teilchen „instantan“ bzw. tachyonisch bzw. retrokausal vermittelt sein, da nur die Energie des Teilchens v>c nicht überschreiten darf.
Zwischen zwei Messungen benötigt die Natur eine Ortsunschärfe damit das alte sich auflösen und das neue sich bilden kann. Damit kollabiert nichts- sondern das eine Teilchen „verläuft“ sich als Welle in die Vergangenheit und das Neue beginnt am Ort Xo zum Zeitpunkt To. Sobald man nicht mehr weiß wo das Teilchen hin ist, merkt man auch nicht mehr, dass es weg ist. Damit meine ich explizit nicht E oder p, diese werden ja immer schärfer. Nur Ort und Zeit des alten Teilchens gehen verloren... Edit: Wobei ich sagen muss, bei der Energie bin ich mir nicht sicher. Logischer wäre es wenn Ort und Energie sich in der Unschärfe verlieren, dafür Impuls und Zeit(punkt) für das Neuerscheinen schärfen. Sprich der Zeitpunkt wann (nicht wo) der Impuls ein neues Teilchen erzeugt, festgelegt wird. |
AW: Die dunklen Pfade des Feynman
Zitat:
Ich finde es vielmehr naheliegend, dass es im Schirm mikroskopische Vorgänge gibt, die nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit stattfinden, wie zB die Entstehung von Bremsstrahlung. Die Quantentheorie hat bezüglich dieser Frage ein offenes Problem, wie es im Detail auch hier Particle creation as the quantum condition for probabilistic events to occur, N. Maxwell 1994 beschrieben wird. |
AW: Die dunklen Pfade des Feynman
Zitat:
Ich finde, das trifft es nicht. Es wäre ja auch zu prüfen, ob diese "new version of non-relativistic quantum theory" überhaupt Bestand hat in diesem Wust von Publikationen. Es geht doch um nichts anderes, als dass da Punkte mit der vorhergesagten Wahrscheinlichkeit auf dem Schirm entstehen. Ich denke, das ziehst du nicht in Zweifel, oder? Wie genau diese Punkte entstehen, trägt nichts zum Verständnis des Doppelspaltexperimentes bei. |
AW: Die dunklen Pfade des Feynman
Zitat:
Eine Frage also, die allerspätestens seit der Entdeckung des laplaceschen "Dämons" gestellt werden kann. Zitat:
|
AW: Die dunklen Pfade des Feynman
Zitat:
Im Bezug zur Unschärfe ist m.E. zu beachten, dass der Impuls keine primäre, sondern eine abgeleitete physikalische Größe ist. Die Masse ist ebenso abgeleitet, wie auch die Geschwindigkeit. Macht es Sinn die Zeit und den Ort als primäre Größen vorrangig zu nutzen? |
AW: Die dunklen Pfade des Feynman
Zitat:
|
AW: Die dunklen Pfade des Feynman
Zitat:
Zitat:
E und p sind als „Potentielle Energie – Kinetische Energie“ die wesentlichen Größen der stationären Wirkung (Lagrangefunktion). Also wie fließen E und p zum nächsten Extremum. Ich frage mich aktuell - falls nicht klar formuliert – ob der Impuls nicht Auslöser einer neuen Welle an einem Ort x zu einem Zeitpunkt to sein kann, während E und Aufenthaltswahrscheinlichkeit für das ursprüngliche Teilchen in der „Quintessenz“ verloren geht. Ich meine wenn „p und c“ sowieso feststehen, kann das E eines Teilchen durch das „Auftreffen“ von p an einem/jedem Ort erneut eine Welle (Teilchen) mit pc=E erzeugen. Das passiert immer dann, wenn p und t durch das „Verlaufen“ der Welle immer genauer werden. Bildlich gesprochen sagt die Zeit „Jetzt“ und der Impuls erzeugt ein neues „Dong“ im QM-Feld und so eine neue Welle mit E = pc. Zumindest für Photonen zunächst vorstellbar… Zitat:
Gruß, EvB |
AW: Die dunklen Pfade des Feynman
Zitat:
Zitat:
Zusätzlich sind Ort und Zeit über die RT's gekoppelt (Zeitdilatation und Längenkontraktion). Die Wellenlänge eines Quantenobjekts gibt nicht nur Aufschluss über die Energie, sondern auch über die Zeit und damit die Unschärfe zwischen dem Ort/der Energie einerseits und der Zeit andererseits. Die Geschwindigkeit der Zeit ist abhängig vom Ort bzw. sie wird immer langsamer, je weiter sich irgendein Punkt i der Raumzeit angenähert wird. Im Minkowskidiagramm wird die Zeit über c*t ztur Länge gemacht, um es besser mit dem Ort in Bezug setzen zu können. Dennoch haben x, y, z und auch t an jedem Punkt der Raumzeit ihren Ursprung bei 0 (bzw. infintesimal kleinem Wert) Zitat:
|
AW: Die dunklen Pfade des Feynman
Hallo antaris,
das ist alles sehr durcheinander für mich was du schreibst. E = pc Das zeigt doch, dass das eine in das andere umwandelbar ist. E beschreibt einfach die Energie und p den Impuls. Bewegen tut sich alles mit c. Bewegung hat nichts mit E oder p zu tun. Nur kannst du c eines Photons nicht messen, wenn E oder p zu klein für eine Wechselwirkung ist. |
AW: Die dunklen Pfade des Feynman
Der Impuls ist doch nicht-relativistisch, also bei massebehaftete Quantenobjekte P = mv nd bei Photonen p = mc = h/lambda und die Berechnung der Energie E = pc ist doch nur für Photonen relevant.
Die Geschwindigkeit und damit der Impuls und die Energie sind aber in Abhängigkeit vom Ort und der Zeit. Schließlich ist c die Geschwindigkeit der Bewegung der Photonen und v die Geschwindigkeit der Bewegung von massebehaftete Quantenobjekte in der Raumzeit. Ohne Bewegungen (Translation in der Raumzeit) gäbe es also gar keinen Impuls (bis auf den Eigendrehimpuls). Ich Frage mich womit E und p sonmst zu tun haben, wenn nicht mit Bewegung? |
AW: Die dunklen Pfade des Feynman
Zitat:
Das gilt auch für das e- da es sich im Higgsfeld mit c bewegt. Vergleichbar mit einem Photon in einem Medium. Du kannst ein e- nicht (im physikalischen Sinne) überholen (weil es sich mit c bewegt). Wenn das gehen würde, wäre der Higgsmechanismus unnötig. Also auch die Materienwelle bewegt sich mit c (im Higgsfeld). Warum, mann dann ein e- beschleunigen kann, ein Photon aber nicht, wollte ich jetzt noch nicht diskutieren. Aber offenbar ist ja, dass das e- dabei nicht wirklich schneller wird (hat ja bereits c erreicht) EDIT: Versuche es noch einmal anders, in Bezug auf das Thema. Das ursprüngliche Teilchen wird durch das "verlaufen" der Welle so schwach, dass es nur noch als virtuells Teilchen existiert und dafür wird ein Anderes zum "leben" erweckt. Es erhält alle Informationen des Alten durch den Impuls (der über 1000 Pfade den Ort x erreicht). |
AW: Die dunklen Pfade des Feynman
Zitat:
Berechne mal die Phasengeschwindigkeit einer deBroglie-Welle mit Masse. Ist möglicherweise ein unerwartetes Ergebnis. Zitat:
|
AW: Die dunklen Pfade des Feynman
Hallo Bernhard
Zitat:
Also „erfand“ er ein Feld, in dem z.B. das e- sich durchbewegen muss, wie ein Photon durch Glas. Du wirst doch nicht sagen, dass das Photon sich im Glas mit v<c bewegt? Im Pfadintegral muss das e- so eine viel größere Strecke (wenn auch mit c) zurücklgen, als ein Photon, dass hier durchrauscht. Der Unterschied von v eines e- und v eines Photons ist ein "ds"- ein "ds" das durch die Wechselwirkung mit dem Higgsfeldsfeld entsteht. Zitat:
https://www.youtube.com/watch?v=FRP4AqZR3UU&t=1996s Zitat:
Die Anzahl der Pfade entspricht „dk“ also auch der Wahrscheinlichkeit (Amplitude/Gaußverteilung) im Pfadintegral für jede Welle. Kurz wenn dk infestimal klein ist, sind es unendliche viele Pfade. Ich weiß/vermute, dass du keine Lust auf das Video hast, aber es ist für mich wirklich sehenswert, da es wohl keine bessere mathematische und bildliche Darstellung eines Teilchens wiedergibt. Zu beiden Fragen: Anderseits geht er nicht auf das Higgsfeld ein. Das ist alles noch zu neu und eine wirklich schöne Beschreibung (außer hier) finde ich nicht. Außer hier: https://scienceblogs.de/hier-wohnen-...rstehen/?all=1 und hier: https://scienceblogs.de/hier-wohnen-...n-ganz-anders/ Higgs hat die Ruhemasse dem Higgsfeld auferlegt, damit das e- keine mehr hat. Damit ist v=c erlaubt und die schwache Wechselwirkung nach dem angedachten Weg erst möglich. |
AW: Die dunklen Pfade des Feynman
Zitat:
|
AW: Die dunklen Pfade des Feynman
Zitat:
Die Beschreibung der Höhe der Amplitude, spiegelt für mich der „Wahrscheinlichkeit“ bzw. der Wirkung im Pfadintegral wieder. Bin nicht sicher, ob ich die richtigen Begriffe verwende, aber ich hoffe der Sinn kommt heraus. Die Phase entspricht dk. Je größer die Phasenverschiebung, desto kleiner die Amplitude. Je kleiner die Amplitude desto größer der Unterschied der Phasengeschwindigkeit (?). Sprich ½ muss einen Umweg machen, damit es gleichzeitig am Ort B ankommt, wenn alle Wellen bei A gleichzeitig starten. Das ist eine unvollständige Beschreibung sollte aber zunächst helfen, die Fragen die ich bezgl. des Pfadintegrals habe aufzuzeigen. |
AW: Die dunklen Pfade des Feynman
O.k ich mach mal weiter bis jemand Stopp schreit. :)
Wie sieht wohl die Überlagerung einer entsprechenden Superpostionswelle (mit Gaußamblitude) aus, wenn diese an einem Ort B reflektiert wird? In meinem inneren Auge, geht die Amplitude gegen Null, wenn das Teilchen/das Amplitudenmaximum auf B trifft. Sprich der Ort und Energie sind maximal unscharf- dafür p und t Kristall klar. Die vorauseilende Welle (v>c) überlagert sich so mit der hintereilenden (v<c)…dass eine Nulllinie entsteht deren Amplitude die Aufenthaltswahrscheinlichkeit und Energie wiederspiegelt. Damit wird der Impuls der Zeitpunkt, beliebig scharf. Hierdurch entsteht ein definierter Impuls p zum Zeitpunkt t am Ort B. EDIT: Ich vermute, dass keine der Wellen in dem Video (Superposition) exakt eine Amplitude von 1 hat (und ein v=c). Also bei den unendlich vielen überlagerten Wellen, die eine fehlt. Damit gibt es nur Wellen mit v>c oder v<c, wobei sie im Mittel c ergeben. Zeitlich betrachtet liegen diese Wellen daher entweder in der Vergangenheit oder in der Zukunft, wenn c die Gegenwart darstellt. Aus diesem Grunde vermute ich, können wir diese nicht messen. Erst bei einer destruktiven Interferenz (nenne es mal tödliche Interferenz, da das Teilchen als solches verschwindet) können Impuls und Zeit, die die c-Barriere nicht kennen, sich dort zeigen. Im selben Moment, trennen sich die Wellen des neuen Teilchens wieder vom Entstehungsort (to) und wanden ihres Weges mit v ungleich c. So oder so ähnlich, natürlich. Das ist max. nur die einfache Darstellung des Feynmanpfads. |
AW: Die dunklen Pfade des Feynman
Zitat:
Es handelt sich um ein grundlegend wahrscheinlichkeitsorientiertes Konzept. Im Gegensatz zur ontischen Interpretation der Wellenfunktion wird das Zufallselement dort in der Wahl des Weges verortet. Das hat allerdings den Preis, dass die Wahrscheinlichkeiten (beim Doppelspalt am Schirm) dann relativ ungewohnt superponiert werden müssen. Die Art der Addition der Wahrscheinlichkeiten erinnert mich eben vielmehr an die Addition echter Feldstärken. EDIT: Übrigens werden auch in der Statistik Wahrscheinlicheiten erst dann multipliziert, wenn verschiedene Ereignisse unabhängig voneinander stattfinden, wie zB das Pasch beim doppelten Würfelwurf. Das führt bei der anschaulichen Interpretation des Pfadintegrals wieder dazu, dass man mit unendlich vielen unabhängigen Kopien des Elektrons rechnet, was wiederum viel eher einem Feldbegriff entspricht. |
AW: Die dunklen Pfade des Feynman
Liste der Anh?nge anzeigen (Anzahl: 1)
Auch wenn das Geschreibsel von mir nicht erhellend sein mag, aber für mich ist eins klar geworden (ob richtig oder falsch kann ich nicht ermessen) – Dass die die mathematische Beschreibung einer ich sag mal „realen Welle“ vs. „QM-(Wahrscheinlichkeitswelle“) gleich erscheinen vermag, aber die Korrelationen von Ort, Impuls, Zeit und Energie sind eben nicht „automatisch“ bzw. nicht auf dieselbe Weise verbunden sind.
Oder anders: Bei der QM-Welle korrelieren zwar die Größen - gehen mathematisch auseinander hervor. Bei einer realen Welle gehen sie aber direkt auseinander hervor und man hat eine mathematische Beschreibung dafür. Es ist daher ein Fehler hier Erklärungsversuche im Verhalten einer realen Welle auf die QM-Welle zu generieren. Anders ausgedrückt der Impuls einer Wasserwelle wird nicht schärfer, wenn sie sich ausbreitet (breiter wird). Daher sind alle vergleichende Ansätze mit ??? verbunden. Die Interpretation ist daher falsch, dass man eben ein breites „dx“ benötige, um eine Aussage über „dp“ zu bekommen. Oder lange warten muss. Die Interpretation wird in diesem Fall nicht vom Wesen der Wahrscheinlichkeit gelenkt, sondern von realen Wellen. Richtig ist – die Wahrscheinlichkeit einen Impuls mit „E/c“ zu messen steigt mit abnehmender Amplitude (dem breiter werden der Ortswelle). Der Einschlagsort, Zeitpunkt sowie der Impuls eines Photons ist bei der Wechselwirkung doch eher dx=dt=dp=dv= 1 bzw. 0 – egal für die Aussage. Ich habe noch einmal ein Bild angefügt. Anhang 649 Anders als bei realen Wellen muss man akzeptieren, dass eine absolute destruktive Interferenz der Aufenthaltswahrscheinlichkeit nicht irgendwo/-wie wieder zum Schwingen anfängt. Eine Amplitude irgendwie generiert wird. Das ist eben keine Welle, sondern eine Aussage – das Ding ist wech. Anders als bei realen Wellen, beschreibt die QM-Welle die Entstehung und das Vergehen von „dx, dE, dt, dp“ selbst. Während bei realen Wellen diese Größen variablen sind (schon existieren). |
AW: Die dunklen Pfade des Feynman
Zitat:
Mir geht es um die Interpretation hinter der Mathematik. Wie sind Spin up und down in der Beschreibung über das Pfadintegral zu erklären. Das ist sicher nicht einfach. Es geht um das Messproblem. Und es geht aus meiner Sicht nicht, ohne dass man die unschärferelation so sieht wie ich es hier versuche (anders) darzustellen. Hossenfelder meinte, dass man irgendwann vielleicht durch Gravitationsmessung weiß, wo das Teilchen durchgeht*. In "meiner" Darstellung geht es durch beide Spalte, wobei die Wellen (die Amplituden) am Ende einfach verufern – sich auslaufen bzw. im Nirvana verschwinden (selbst kein neues Teilchen erzeugen). Aber jegliche Information all dieser Wechselwirkungen/Interferenzen (Pfade) werden offenbar im schärfer werdenden Impuls (dp->0, Amplitude p=1)zusammengetragen– bis irgendwo, zu dem dann exakt festgelegten Zeitpunkt (dt->0, Amplitude t=1) ein neues Teilchen entsteht, das dann nicht nur die Information wo und wann, sondern eben auch das wie innehat. Und wenn du den Spin am Ort A misst oder am Ort B, dann änderst du eben auch die Gesamtheit aller Interferenzen, die im Impuls des neuen Teilchens gemessen werden. *Bei der Messung des Gravitationspotenzials nach Hossenfelder würde man also messen, dass die Energie sich immer weiter ausbreitet und ausbreitet und ausbreitet. In dem Moment, wenn das ursprüngliche Teilchen sich in das nichts ausgebreitet hat, nicht mehr messbar ist, springt an irgendeinem Ort der Wert wieder auf 100% des ursprünglichen Teilchens. Jetzt zu glauben, dass es das ursprüngliche Teilchen ist, das sich spontan lokalisiert hat und nicht doch einfach ein neues Teilchen „einfach eine Kopie des Alten“ finde ich…unlogisch und seltsam. |
AW: Die dunklen Pfade des Feynman
Zitat:
Technisch leichter durchführbar wären aber wohl Messungen am elektromagnetischen Feld. So könnte man zB den Abschirmungseffekt von Orbitalen im Atom untersuchen. Die "Ontiker" würden hier wohl statische Abschirmungsfelder erwarten, Vertreter der orthodoxen QM wohl eher ein fluktuierendes Abschirmungsfeld. |
AW: Die dunklen Pfade des Feynman
Liste der Anh?nge anzeigen (Anzahl: 1)
Zitat:
Aber egal – so ist es nun mal :) Ich vermute, dass das nachfolgende folgende Bild eher der Verteilung der Amplituden der "n-Wellen" in Superposition entspricht. Die Gauß-/Normalverteilung ist zwar auch natürlich, aber so wäre es nachvollziehbarer. Anhang 650 Es ist ja schon verwunderlich, dass die Vergangenheit uns gefühlt mehr prägt als die Zukunft - bzw. realer erscheint. Bin gedanklich noch nicht ganz durch, aber ja das Higgsfeld erscheint mir nützlich. Denn Photonen kennen weder Zeit noch Raum. |
AW: Die dunklen Pfade des Feynman
Zitat:
Ein ganz ähnliches Problem ergibt sich eventuell auch bei einer Messung mit Gravitonen. Vielleicht können wir es ja experimentell prinzipiell nicht klären? Dann bliebe nur noch Ockham's razor ;) |
AW: Die dunklen Pfade des Feynman
Zitat:
Lokal oder nicht-lokal Wo macht man den Schnitt? Für lokal spricht zumindest die ART. Für nicht lokal? |
AW: Die dunklen Pfade des Feynman
Zitat:
Die Nichtlokalität der QM darf nicht einfach vernachlässigt werden. Bell läßt grüßen. |
AW: Die dunklen Pfade des Feynman
Zitat:
Zitat:
Leider nicht frei verfügbar: https://www.nature.com/articles/s41567-022-01831-5 Aber vielleicht genügt die Überschrift :rolleyes: |
AW: Die dunklen Pfade des Feynman
Zitat:
|
| Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:22 Uhr. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
ScienceUp - Dr. Günter Sturm