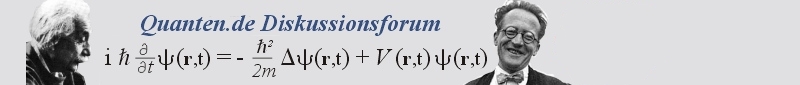
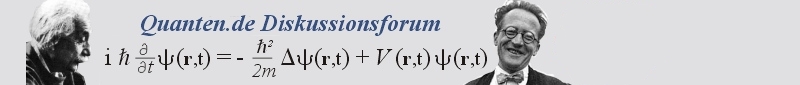 |
Axiome der Quantenmechanik - orthodoxe Interpretation
Ich möchte im Folgenden kurz die üblicherweise verwendeten Regeln zur Quantenmechanik zusammenfassen und bzgl. der 'orthodoxen' bzw. sogenannten 'Kopenhagerer' Interpretation nach Bohr et al. kommentieren.
Kursiv gesetzter Text bezieht sich auf reale Systeme und deren Dynamik, Präparation und Messung, sowie tatsächlich messbare Größen d.h. Observablen sowie deren Messwerte. Normal gesetzter Text bezieht sich auf rein mathematische Objekte, die die genannten physikalischen Systeme etc. in gewissem Sinne repräsentieren. Konsens 1. Die Beschreibung eines Quantensystems erfolgt im Rahmen eines separablen Hilbertraumes 2. Der Zustand eines einzelnen isolierten Quantensystems wird durch einen normierten Vektor |q> als Element dieses Hilbertraumes beschrieben. In vielen praktischen Fällen entspricht dies einer Wellenfunktion q(x). 3. Die Zeitentwicklung eines einzelnen isolierten Quantensystems wird durch einen unitären Zeitentwicklungsoperator U(t) beschrieben; diese Regel ist vollständig äquivalent zur Schrödingergleichung Speziell orthodoxe und verwandte Interpretationen - nicht allgemein akzeptiert 4. Eine beobachtbare Größe, d.h. eine sogenannte Observable eines Quantensystems wird durch einen selbstadjungierten Operator A repräsentiert, der auf die Zustandsvektoren wirkt. 5. Die möglichen Messwerte einer Observablen entsprechen dem Spektrum d.h. den verallgemeinerten Eigenwerten a des korrespondierenden selbstadjungierten Operators A, d.h. (A - a) |a> = 0 6. Sei das Quantensystem in einem Zustand präpariert, der mittels eines Zustandsvektors |q> repräsentiert wird. Wird eine Messung einer Observablen, repräsentiert durch den Operator A, durchgeführt, so ist die Wahrscheinlichkeit p(a), den Messwert a zu erhalten, gegeben durch p(a) = | <a|q> |² Dies ist die sogenannte Bornsche Regel. Verwandt damit ist die Regel, dass der Erwartungswert für die Observable A über viele Messungen an identisch präparierten Systemen gegeben ist durch <A> = <q| A |q> 7. Nach einer Messung und insbs. im Falle aufeinanderfolgender Messungen am selben Quantensystemen kann eine Messung mit Messwert a aufgefasst werden als Präparation des Systems in einen neuen initialen Zustand, repräsentiert durch den Zustandsvektor |a>, der in der Folge für die weitere Zeitentwicklung verwendet wird. Dies ist das sogenannte von-Neumannsche Projektionspostulat. Zu Bedeutung und Varianten der Regeln. (2) - dass ein einzelnes Quantensystem immer vollständig durch einen Zustandsvektor beschrieben wird, führt zusammen mit (3) und (7) zu Inkonsistenzen - siehe unten. Daher existieren Varianten dieser Interpretation, denen zufolge 2.a der Zustandsvektor nicht direkt ein einzelnes System repräsentiert, sondern lediglich unser Wissen über dieses System - oder 2.b der Zustandsvektor nicht ein einzelnes System sondern lediglich ein (reales oder gedachtes) Ensemble identisch präparierter Systeme repräsentiert (Ensemble-Interpretation). Das von Neumannsche Projektionspostulat (7) kann in gewisser Weise motiviert werden durch die Betrachtung eines makroskopischen Messgerätes, dessen Zeiger durch Zustandsvektoren |Za> entsprechend der Messwerte a repräsentiert wird. Da die Mathematik der Quantenmechanik sogenannte Superpositionszustände zulässt, und diese sogar essentiell zur Beschreibung experimentell gesicherter Resultate sind, würde dies aufgrund von (3) zu Superpositionen makroskopischer Zeiger wie "zeigt nach ober und zeigt gleichzeitig nach unten" führen. Da dies experimentell offensichtlich ausgeschlossen ist, führte von Neumann das Projektionspostulat (7) ein - oft bezeichnet als "Kollaps der Wellenfunktion". In der o.g. Formulierung ist dieses Postulat streng genommen zu eng gefasst, wie Beispiele zur Ortsmessung zeigern: i) Tröpfchen in einer Nebelkammer oder schwarze Flecken auf einer Photoplatte stellen keine exakt scharfe Messung mit einem exakten Eigenwert dar, sondern unscharfe Messungen. ii) Speziell nach der Absorption eines Photons liegt im Zustand nach der Messung überhaupt kein Photon mehr vor, d.h. es ist sinnlos, einen wie auch immer gearteten Eigenzustand des Photons zu postulieren. Das Projektionspostulat kann jedoch mittels geeigneter mathematischer Methoden modifiziert werden, so dass diesen Messungen Rechnung getragen wird. Das weiter unten zu diskutierende fundamentale Problem wird dadurch jedoch nicht gelöst. Die Interpretationen gemäß 'Kopenhagen' haben je Physiker einen jeweils etwas eigenen Flair, z.B. hinsichtlich der dessen, was der Zustand exakt bedeutet - Repräsentant der Realität, Repräsentant unsere Wissens über die Realität, Repräsentant eines Ensembles. Insgs. stimmen jedoch alle darin überein, dass: - die o.g. Regeln im wesentlichen d.h. bis auf Varianten und Interpretationen die gültigen Regeln darstellen - die Quantenmechanik den Messprozess nicht vollumfänglich beschrieben kann; es existiert immer ein Rückgriff auf eine klassische Beschreibung des Messgerätes und der Messwerte - die Quantenmechanik einen objektiv stochastischen Element enthält, d.h. dass die o.g. Wahrscheinlichkeiten nicht Ausdruck unserer Unkenntnis sondern ein Element der Natur selbst sind - dieses Regelwerk der Quantenmechanik im Wesentlichen geschlossen, d.h. nicht verbesserbar ist - die Quantenmechanik dahingehend vollständig ist, dass sie es erlaubt, für praktisch alle Phänomene detaillierte und zutreffende Berechnungsmethoden und Vorhersagen zur Verfügung zu stellen - es nicht Aufgabe der Quantenmechanik sei, mehr als das zu leisten, d.h. insbs. nicht die Frage zu beantworten, wie sich ein System ohne Beobachtung bzw. Messung tatsächlich verhält Insofern sind viele Anhänger dieser 'orthodoxen Lesart' auch heute noch mit diesem Regelwerk zufrieden, da es in der Praxis bisher immer funktioniert hat. Einwände von Schrödinger, Einstein u.a., die Quantenmechanik müsse z.B. eine vernünftige Aussage treffen, in welchem Zustand sich die arme Katze in der Kiste vor der Öffnung derselben denn wirklich befinde, lehnen sie als letztlich unwissenschaftlich ab, da sich Wissenschaft nur an objektiv überprüfbaren Fakten zu orientieren habe - und das ist bei einer geschlossenen Kiste eben nicht der Fall. |
AW: Axiome der Quantenmechanik - orthodoxe Interpretation
Zitat:
Aber das nur am Rande - danke für den m.E. gelungenen Überblick über Postulate und Regeln der QM. |
AW: Axiome der Quantenmechanik - orthodoxe Interpretation
Zitat:
Um im o.g. Formalismus zu bleiben: Ausgehend von einem Superpositionszustand |q> |q> = |spin up> + |spin down> eines Quantensystems vor der Messung folgt nach von Neumann (Regel 3) der Superpositionszustand des Gesamtsystems |q'> = |spin up, Zeiger zeigt up> + |spin down, Zeiger zeigt down> was ihn letztlich zu seinem Projektionspostulat (7) zwingt. Zeh et al. zeigen im Rahmen der Dekohärenz lediglich, dass die reduzierte Dichtematrix des Gesamtsystems nach der Messung keine Interferenzterme mehr enthält; allerdings lautet diese reduzierte Dichtematrix immer noch Q' = Q'(Zeiger zeigt up) + Q'(Zeiger zeigt down) was wir so nie beobachten. Übersetzt auf Katzen hieße dies, dass die tote und die lebende Katze im Formalismus beide vorhanden und stabil sind. Keine zerfällt, keine verschwindet. Es gibt zwei naheliegende Schlussfolgerungen: a) man benötigt weiterhin eine Art Projektionspostulat b) man akzeptiert, das die beiden Katzen weiterhin real existieren, entsprechend auch beide Beobachter, und jeder nur 'seine' Katze sieht Dieses Problem - und darauf weist Zeh mehrfach explizit hin - löst die Dekohärenz nicht. |
AW: Axiome der Quantenmechanik - orthodoxe Interpretation
Zitat:
Ich habe mich da wohl schon vor längerer Zeit durch einen Artikel auf der Homepage unseres Forums in die Irre leiten lassen, der eine Ablösung des Kollaps durch die Dekohärenz suggeriert und offensichtlich ungenau ist: Schrödingers Katze kann aufatmen |
AW: Axiome der Quantenmechanik - orthodoxe Interpretation
Zitat:
Ist bestimmt nicht schlecht, aber einige falsche Aussagen fallen beim Querlesen auf. Zitat:
|
AW: Axiome der Quantenmechanik - orthodoxe Interpretation
Jetzt sind wir aber deutlich vom Thema abgekommen.
|
AW: Axiome der Quantenmechanik - orthodoxe Interpretation
Zitat:
EDIT:Aber ein bisschen Senf dazu von mir – in der Hoffnung, dass ich deine Kritik (TomS) darin wiedergebe. Zitat:
Es ist keine Lösung für die Superposition und damit - ja o.k. eine Lösung für die Katz ;) |
AW: Axiome der Quantenmechanik - orthodoxe Interpretation
Möchte den Thread von TomS nicht kaputt machen. Daher meine letzte Antwort.
Du hast geschrieben, dass es den Kollaps nicht löst. Es geht aber (denke ich) um den Kollaps...und bringst dann ein Beispiel, dass den Kollaps nicht löst? |
AW: Axiome der Quantenmechanik - orthodoxe Interpretation
Zitat:
Mal ganz einfach. Wenn wir die Kiste öffnen, finden wir z.B. eine tote Katze. Daher gehen wir davon aus, dass sie schon etwas länger tot ist. Der Zustand war also die Katze ist tot. Die Quantenmechanik nach orthodoxer Interpretation liefert das Ergebnis die Katze ist zugleich lebendig und tot. Die Dekohärenz übersetzt man gerne mit die Katze ist lebendig oder tot. Auch letzteres ist aber nicht der Zustand der Katze. Der Zustand ist die Katze ist tot. Anderes Beispiel: wenn der Geschichtslehrer fragt, ob Theoderich König der Ost- oder Westgoten war, dann gibt es auf die Antwort “Theoderich war König der Ost- oder der Westgoten” Null Punkte. |
AW: Axiome der Quantenmechanik - orthodoxe Interpretation
Ein Teilchen verhält sich solange als Welle, bis es eine Wirkung zeigt. Typisches Beispiel ist die Spur eines Gammaquants in der Nebelkammer. Solange das Quant keine Wechselwirkung ausübt, solange verhält es sich als Welle. Triff das Gammaquant auf Atome und ionisiert diese, nimmt es einen Teilchencharakter an, der den Ort in Form einer Nebelspur offenbart.
|
AW: Axiome der Quantenmechanik - orthodoxe Interpretation
Zitat:
Keine Kritik an dir, man findet die Geschichten ja allenthalben. |
AW: Axiome der Quantenmechanik - orthodoxe Interpretation
Zitat:
Zitat:
Schrödingers Katzes Schicksal steht schon vor dem Öffen der Kiste fest. Die Katze ist ein makroskopisches Objekt. Jeder Forensiker kann den Toteszeitpunkt im nachhinein feststellen. Mikroskopische Ojekte mögen sich anders, nach den Gesetzen der QM, verhalten. |
AW: Axiome der Quantenmechanik - orthodoxe Interpretation
Zitat:
Seine einzige Wechselwirkung ist laut Quantenelektrodynamik der fundamentale Vertex https://i.stack.imgur.com/IPKwS.png Wie man sieht, endet die Schlangenlinie (das Photon): seine einzige Wechselwirkung besteht darin, absorbiert (oder erzeugt) zu werden. Was da die Spur erzeugt, das ist nicht ein einzelnes Photon sondern eher so etwas wie ein Quasiteilchen. |
AW: Axiome der Quantenmechanik - orthodoxe Interpretation
Zitat:
Das Projektionspostulat ist keine Erklärung, es eliminiert lediglich einen offensichtlichen Defekt der damaligen Berechnungsmethoden mittels eines Eingriffs, durch den die Theorie entweder notorisch nicht-real oder logisch inkonsistent wird (immerhin hat man die Wahl ;-) Die Dekohärenz erklärt, wie klassische Zustände aussehen, aber sie liefert für anstelle des "Katze ist gleichzeitig lebendig und tot" lediglich "Katze ist lebendig oder tot"; die Beobachtung liefert aber in jedem Einzelfall immer nur eines davon, also z.B. "Katze ist tot". Zitat:
Wenn ich ein vollständiges und in sich konsistentes System an Axiomen, Postulaten oder was auch immer habe, kann ich daraus experimentell überprüfbare Vorhersagen ableiten. Die Theorie soll bitteschön das liefern, was ich beobachte, nicht etwas, was ich nicht beobachte, oder eine Alternative "es könnte dies oder auch das sein, das musst du anhand der Messung entscheiden". Stell dir vor, eine Theorie führt auf eine Gleichung z³ + az² + bz + c = 0 mit komplexe Zahlen z sowie einer reellen und zwei komplexen Lösungen. Anhand der experimentellen Befunde weiß ich, dass letzteres ausgeschlossen ist. Nun konfrontiere ich den Theoretiker mit dieser Beobachtung, und er "verbessert" seine Theorie, indem er ein Postulat hinzufügt: "zulässig sind ausschließlich reelle Lösungen". Erklärt das etwas? Nein. Und eine Geschichte, dass der Detektor die reelle Lösung selektiert, ohne eine Berechnung, wie und warum? Erklärt die was? Nein. Schau dir die Dirac-Gleichung an. Sie liefert doppelt so viele Lösungen wir erwartet. Akzeptiert man diese Lösungen und interpretiert sie geeignet, erhält man nach Entdeckung der neu gefunden Lösungen den Nobelpreis (na ja, ganz so war es nicht) https://en.wikipedia.org/wiki/Positron#History Oder die elektroschwache Wechselwirkung. Sie liefert so etwas wie ein "schweres Photon". Dito - akzeptiert man die neue Vorhersage, dass die in sich sowie mit bisherigen Experimenten verträgliche Theorie - neben vielen anderen - diese neue Vorhersage macht, so erhält man den Nobelpreis. https://en.wikipedia.org/wiki/W_and_Z_bosons Zitat:
Zitat:
Aber dennoch, eine Erklärung haben wir nicht. (Wenn man auf die Mathematik zur Dekohärenz vertraut, ist die Viele-Welten-Theorie tatsächlich die beste. Sie postuliert nämlich nicht die Existenz verschiedener Zweige, sie akzeptiert lediglich alle mathematischen Vorhersagen = alle Lösungen der Gleichung, und sie erklärt mathematisch, warum wir nur eine Lösung beobachten) |
AW: Axiome der Quantenmechanik - orthodoxe Interpretation
Zitat:
Ob wir genau eine Katze in genau einem definierten Zustand beobachten, oder ob wir in einem Beschleunigerexperiment ein Photon genau hier detektieren und nicht dort, ist beides gleichermaßen unverstanden. Man kann das offen aussprechen, oder sich hinter Metaphysik und Dogmatik verstecken, dass die Quantenmechanik eben nur stochastische Aussagen macht und man bitte nicht weiter nachfragen soll. Mit der Einstellung kommt man natürlich ganz pragmatisch durch's Physikerleben. |
AW: Axiome der Quantenmechanik - orthodoxe Interpretation
Zitat:
|
AW: Axiome der Quantenmechanik - orthodoxe Interpretation
Zitat:
|
AW: Axiome der Quantenmechanik - orthodoxe Interpretation
Zitat:
Es geht um eine Art Superpositionszustand. Wenn du einen solchen zwischen "Kern nicht zerfallen" und "Kern zerfallen" hast, denkst du auch nicht plötzlich an zwei Kerne. Warum soll das bei Katzen anders sein? |
AW: Axiome der Quantenmechanik - orthodoxe Interpretation
Zitat:
Zitat:
"Eigene Welt" bedeutet für mich, dass es keine Wechselwirkungen zwischen diesen gibt. |
AW: Axiome der Quantenmechanik - orthodoxe Interpretation
Zitat:
Ein Gammaquant wandelt sich nach einer Wechselwirkung in ein Elektron und in ein Positron um, welche in der Nebelkammer eine charakteristische Spur ziehen. Auch das Positron zieht, wenn auch spiegelbildliche, Spur in der Nebelkammer. Die Spur einsteht duch kondensierende Wasserdampfmoleküle, denen Elektronen durch den Stoß des Positrons entrissen wurden. Warum findet keine Annihilation zwischen Positron und diesen Elekron des gestoßenen Atoms statt? |
AW: Axiome der Quantenmechanik - orthodoxe Interpretation
Zitat:
Zitat:
Wenn ich einen Würfel nehme und sage, der Würfel zeigt "gerade" oder "ungerade", wenn ich die Box öffne, dann ist das keine unaufgelöste Superposition mehr? Was ich meine: Führt die Dekohärenz im Fall „TOT/UNTOT“ zur Verletzung der Bell’schen Ungleichung? Ich vermute nein? *Kannst du meiner Argumentation - meinem Problem mit der Dekohärenz - etwas abgewinnen? ("Antwort 10") |
AW: Axiome der Quantenmechanik - orthodoxe Interpretation
Zitat:
Rein mathematisch findet aber keine “Vervielfachung von Welten” sondern eher ein “Verzweigen und Ausdünnen” statt. |
AW: Axiome der Quantenmechanik - orthodoxe Interpretation
Zitat:
|
AW: Axiome der Quantenmechanik - orthodoxe Interpretation
@ Eyk van Bommel - ich verstehe nicht, was du meinst.
|
AW: Axiome der Quantenmechanik - orthodoxe Interpretation
Zitat:
Zitat:
Als würde ein verschränktes Teilchenpaar schon auf halber Strecke seinen Zustand festlegen, weil es nicht vollständig isoliert werden kann. Aber das ist alles nicht so wichtig für mich. Es beginnt auch beim Konzept der Dekohärenz mit einer Superposition und der Schrödingergleichung – oder nicht? Es ist zumindest kurz vorhanden. Aber das Messproblem hat doch nichts mit der Dauer des Aufrechterhaltens zu tun oder müssen verschränkte Teilchen einen Mindestabstand zurücklegen, damit das Messproblem "mathematisch" auftaucht? 2.) Zur Frage mit der Katze, verstehe ich den Einwand mit dem „oder“ nicht. Das „oder“ hier sagt nun mal aus, dass der Zustand fixiert/determiniert ist. Ich muss nicht nachsehen, welchen Zustand die Katze eingenommen hat. Das machen nur die, die glauben dazu benötigt man ein Bewusstsein. So wie wir beim Mäxle-Spiel den Becher heben müssen, um die Augen zu zählen. Die Würfel sind zunächst in „Superposition“ (also mal angenommen), dann kommt die Dekohärenz und sorgt für die Determinierung der Augenzahl… Ich muss, um meine Punkte zu zählen, trotzdem den Becher heben – und das Ergebnis wird zufällig sein. Aber wird das Ergebnis nun die Bell’sche Ungleichung verletzen? Die Würfel in Superposition würden es ja wohl? EDIT: Es ist klar, dass es sprachlich unsauber ist, aber ich denke man erkennt so besser was ich meine. Die Ergebnisse einer Messung eines Zustand "Superposition" und "klassisch" ist je so bestimmbar. |
AW: Axiome der Quantenmechanik - orthodoxe Interpretation
Zitat:
In allen Szenarien, wo die frequentistische Interpretation anwendbar ist, ist die subjektivistische ebenfalls anwendbar, und führt zu den gleichen Wahrscheinlichkeiten. Deshalb rutscht man schnell in die subjektivistische Interpretation, wenn man nicht aufpasst. Diese Interpretation verwischt leider den Unterschied zwischen richtig und falsch. Und zwar eigentlich auch schon bevor sie auf Situationen angewendet wird, wo es gar keine richtigen Wahrscheinlichkeiten mehr gibt (bzw. geben kann). Ob man dies dann Inkonsistenzen nennen will, ist Geschmacksache. |
AW: Axiome der Quantenmechanik - orthodoxe Interpretation
Zitat:
Wenn man (7) im Kontext bedingter Wahrscheinlichkeiten interpretiert - oder wenn man es weglässt - vermeidet man diese Inkonsistenz. Und wenn man auf die Regeln zur Einführung des "objektiv stochastischen Elementes" verzichtet, dann werden 2.a und 2.b nicht erzwungen, es gibt dann weitere Alternativen, insbs. realistische, nicht-stochastische Interpretationen. |
AW: Axiome der Quantenmechanik - orthodoxe Interpretation
Im Folgenden einige Kritikpunkte eher aus der Innenansicht, d.h. zunächst ausgehend von (1) bis (7).
Zitat:
In dieser Formulierung ist (7) zu eng gefasst, wie Beispiele zur Ortsmessung zeigern: i) Tröpfchen in einer Nebelkammer oder schwarze Flecken auf einer Photoplatte stellen keine exakt scharfe Messung mit einem exakten Eigenwert dar, sondern unscharfe Messungen. ii) Speziell nach der Absorption eines Photons liegt im Zustand nach der Messung überhaupt kein Photon mehr vor, d.h. es ist sinnlos, einen wie auch immer gearteten Eigenzustand des Photons zu postulieren. Das Projektionspostulat kann jedoch mittels geeigneter mathematischer Methoden modifiziert werden, so dass diesen Messungen Rechnung getragen wird. Der von Neumannsche Messprozess wird als Wechselwirkung des zu messenden Systems mit einem Messgerät dargestellt. Dabei wird für das Messgerät ein Zustand |Za> eingeführt, d.h. Messgerät und gemessenes System befinden sich zuletzt im Zustand Zustand |a, Za> bzw. zunächst in einem entsprechenden Superpositionszustand, der wiederum das Postulat (7) erfordert, da keine Superposition eines Zeigers zu verschiedenen Messwerten beobachtet wird. Dabei wird jedoch ignoriert, dass das Messgerät ein komplexes Vielteilchensystem ist, für das die o.g. Formulierung nicht als Axiom eingeführt werden kann; vielmehr müsste der “effektive Zustand” |Za> aus dem Zustand des Vielteilchensystems abgeleitet werden. Dies leistet die Dekohärenz. Sie ersetzt jedoch nicht (7), da die Superpositionen letztlich nicht verschwinden. Das Ergebnis der Dekohärenz ist jedoch ein Zustand, der eine Regel wie (7) als fundamentales Axiom fragwürdig erscheinen lässt. In anderen Fällen verbietet es sich, gewisse Beobachtungen als Messung mit (7) aufzufassen, da die Anwendungen von (7) zu falschen Vorhersagen führt. Betrachtet man jedes Tröpfchen einer Spur in der Nebelkammer als (unscharfe) Ortsmessung, so würde die Projektion auf einen Zustand führen, der näherungsweise isotrop ist und daher die offensichtlich vorhandene Richtung der Spur (entspr. des Impulses) verliert. Die gerichteten Spuren folgen dagegen direkt aus einer einfachen quantenmechanischen Berechnung ohne (7). Insgs. läuft dies daraus hinaus, dass Beobachtungen existieren, die im o.g. Sinne nicht als Messung interpretiert werden können. Fasst man ein einzelnes Tröpfchen als Ortsmessung auf, folgt das gerade diskutierte Problem. Fasst man die gesamte Spur als Messergebnis auf, existiert kein entsprechender Operator A, da die Spur sicher nicht instantan entsteht, (7) jedoch ausschließlich für instantane Messungen formuliert ist. Nicht zuletzt widersprechen sich (3) und (7), da (3) eine unitäre, lineare und invertierbare Vorschrift auf dem Hilbertraum darstellt, (7) jedoch eine nicht-unitäre, nicht-lineare und und nicht-invertierbare Vorschrift. (3) ist deterministisch, (7) zusammen mit (6) dagegen explizit stochastisch. Als Konsequenz muss letztlich entschieden werden, wann (3) und wann (7) anzuwenden ist. Dazu existiert keine Regel - und es kann auch keine existieren, da ja der Messprozess als quantenmechanische Wechselwirkung des zu messenden Systems mit dem Messgerät gemäß (3) zu beschreiben ist, was jedoch im Widerspruch zu (7) steht. Es läuft darauf hinaus (7) anzuwenden, wenn eine Messung erfolgt, wobei es keine fundamentale Regel gibt, die erklärt, was eine Messung ist und wann diese stattfindet; dies bleibt je Einzelfall dem Physiker überlassen (interessanterweise war es jedoch bisher immer möglich, dies konsistent festzulegen). Die Quantenmechanik verwendet in dieser Formulierung also den undefinierten und undefinierbaren Begriff der Messung. Zu (6) Einige der zuvor genannten Kritikpunkte treffen auch auf (6) zu. Darüberhinaus existieren weitere. (6) erscheint oft nicht als fundamentale Regel sondern als Konsequenz anderer mathematischer Modelle, die ohne (6) und (7) formuliert werden können. Es ist möglich, (6) aus dem Begriff des sogenannten Finkelstein-Hartle Frequency Operators zumindest zu motivieren. Gleason’s theorem besagt, dass wenn ein Wahrscheinlichkeitsmaß auf einem Hilbertraum eingeführt werden soll, (6) die einzig mögliche Form darstellt. Als Konsequenz sollte (6) keine fundamentale sondern eine abgeleitete Regel darstellen. Darüberhinaus erscheint es wünschenswert, zu erklären, warum überhaupt Wahrscheinlichkeit eingeführt werden sollen. Zu (5) Betrachtet man die Konstruktion eines klassischen Messgerätes z.B. zur elektrodynamischen Vorgängen, so ist letztlich der Weg von den mathematischen Größen wie Ladungen, Strömen und Feldern hin zu Anzeigen durchgehend erklär- bzw. berechenbar. In der Quantenmechanik ist dies für einen Operator A und das zugehörige Messgerät völlig unklar. Weder kann für ein gegebenes Messgerät der Operator A konstruiert werden, noch folgt aus einem Operator A die Konstruktion des Messgerätes. Letztlich hängt auch dies am undefinierten Begriff der Messung. |
AW: Axiome der Quantenmechanik - orthodoxe Interpretation
Zitat:
Zitat:
Weniger ehrlich ist es aus meiner Sicht, wenn versucht wird zu verschleiern, dass ein Bayes'scher Prior falsch sein kann, obwohl er doch nur subjektiv ist (https://math.ucr.edu/home/baez/bayes.html): Zitat:
Allerdings hatte ich mich einfach schlicht eines Urteils enthalten wollen, wie wahr die Aussage "(3) und (7) sind miteinander unverträglich" aus meiner Sicht ist. Ich könnte versuchen die Aussagen (3) und (7) auch aus Sicht der Ensembleinterpretation (im Kontext der "consistent histories" Interpretation) zu vergleichen, um zu verdeutlichen, wie unklar es ist, ob sie wirklich unverträglich sind. Vielleicht später, jetzt habe ich schon genug geschrieben. Zitat:
|
AW: Axiome der Quantenmechanik - orthodoxe Interpretation
Zitat:
(3) postuliert eine unitäre Zeitentwicklung, (7) einen nicht-unitären Kollaps. Wendet man beides auf den selben Prozess an, ist das offensichtlich inkonsistent. Der Ausweg besteht scheinbar darin, (7) ausschließlich auf eine Messung anzuwenden, (3) auf alle anderen Fälle. Da eine Messung jedoch sicher irgendwie einer Wechselwirkung mit dem Messgerät entspricht - auch wenn wir nicht wissen wie - führt dies wiederum zu einer Inkonsistenz. Dieser Defekt, dass eine Wechselwirkung zu einer Messung führt, wobei die Regeln für die Messung denjenigen für die Wechselwirkung widersprechen, ist in der orthodoxen Interpretation nicht lösbar. Nun müsste einerseits festgelegt werden, was eine Messung ist und wofür (7) gilt, und was keine ist d.h. wofür (3) gilt. Fragt man nach der Definition einer Messung, so liefert (1 - 7) keine Antwort. Dass ein System von Regeln oder Axiomen an einer zentralen Stelle einen undefinierten und offenbar undefinierbaren Begriff verwendet, würde ich tatsächlich nicht mehr als inkonsistent sondern als logisch völlig abwegig bezeichnen. Fun fact: die so zusammengebastelte Interpretation funktioniert FAPP, so dass sie sich tatsächlich in der Praxis durchsetzen konnte und wohl auch heute noch die am häufigsten dargestellte Interpretation der Quantenmechanik ist. Jede Lösung des Problems muss in irgendeiner Form Inkonsistenzen vermeiden, d.h. Regeln aus (1 - 7) abschwächen, modifizieren oder ganz fallen lassen. Dazu gibt es diverse Ansätze, keinen davon würde ich noch als „die orthodoxe Quantenmechanik“ bezeichnen. |
AW: Axiome der Quantenmechanik - orthodoxe Interpretation
Zitat:
Zitat:
Umgekehrt ist mir aber auch klar, dass ich hier mit einem Befürworter der Viele-Welten-Interpretation diskutiere. Also kann ich genauso wenig behaupten, die orthodoxe Quantenmechanik würde alle Probleme lösen. Nun reicht für die Anwendungen der QM, die in meiner Arbeit auftreten, die Ensemble-Interpretation voll aus. In gewisser Hinsicht ist sie in diesem Kontext sogar schlicht und einfach die angemessene Interpretation, und zwar auch gerade in der Weise, wie klassische Physik und Quanten-Physik dabei vermischt werden. Ich bin mir aber durchaus auch bewusst, dass es (ganz konkrete, bereits durchgeführte) Experimente gibt, für welche die Ensemble-Interpretation eben nicht ausreicht. Und aus meiner Sicht entstehen die Probleme bei diesen konkreten Experimenten eben tatsächlich aus der Interpretation der Wahrscheinlichkeit. Aber hier ist man immer noch im "Laborkontext". Wenn es jetzt darum geht, die Quantenmechanik auf das ganze Universum anzuwenden, dann kann selbst eine "verbesserte" Interpretation der Wahrscheinlichkeiten die Probleme nicht lösen. Und in diesem Kontext ist ja auch die Viele-Welten-Interpretation entstanden, und heutige Befürworter wie Sean Carroll kommen ja auch aus dieser Ecke. |
AW: Axiome der Quantenmechanik - orthodoxe Interpretation
Sean Carroll
https://de.wikipedia.org/wiki/Sean_M._Carroll deutsch https://en.wikipedia.org/wiki/Sean_M._Carroll englisch |
AW: Axiome der Quantenmechanik - orthodoxe Interpretation
Und wer noch mehr dazu hören möchte
Hossenfelderhttp://backreaction.blogspot.com/202...ics-5.html?m=1 Zum Messproblem |
AW: Axiome der Quantenmechanik - orthodoxe Interpretation
Zitat:
Zitat:
Zitat:
Zitat:
|
AW: Axiome der Quantenmechanik - orthodoxe Interpretation
Zitat:
Zitat:
Zitat:
|
AW: Axiome der Quantenmechanik - orthodoxe Interpretation
Zitat:
Zitat:
Im Falle der Interpretationen zur Quantenmechanik sind dagegen unterschiedliche Meinungen möglich. Das ist keine Konsequenz irgendwelcher Rechnungen sondern der simplen Tatsache, dass sie existieren und funktionieren. Zitat:
In der Jugendorganisation der SPD wird man ein anderes und insbs. breiteres Politikverständnis vermitteln als im Studium der Politikwissenschaften. Zitat:
Ja, letzteres wohl im Sinne der prinzipiellen Möglichkeit. EDIT: gerade nachgelesen, Wheeler hat bereits in den 50er an der Geometrodynamik gearbeitet, d.h. das war schon Thema in Princeton |
AW: Axiome der Quantenmechanik - orthodoxe Interpretation
Zitat:
@Jakito: Mir hat man im Studium halb scherzhaft den Satz: "Lieber veröffentlichen, als verheimlichen" mit auf den Weg gegeben. Wissenslücken darzustellen ist in diesem Sinne sicher kein Zeichen von Schwäche oder gar Dummheit. Siehe auch: J. Hance, S. Hossenfelder, What does it take to solve the measurement problem? Dort wird ebenfalls recht offen angesprochen, dass an der Quantenmechanik noch gearbeitet werden muss. |
AW: Axiome der Quantenmechanik - orthodoxe Interpretation
Zitat:
Zitat:
Im vorliegenden Fall geht es mir ja gar nicht darum, irgendeine exotische Interpretation in den Mittelpunkt einer Einführungsvorlesung zu stellen, lediglich darum, nicht den Eindruck zu erwecken … siehe meine Signatur. |
AW: Axiome der Quantenmechanik - orthodoxe Interpretation
Zitat:
|
AW: Axiome der Quantenmechanik - orthodoxe Interpretation
Was wird wohl früher geklärt. Das Messproblem oder das Collatz-Problem https://de.wikipedia.org/wiki/Collatz-Problem :D ?
|
AW: Axiome der Quantenmechanik - orthodoxe Interpretation
Zitat:
Der Grund ist einfach: Wenn das Collatz-Problem gelöst ist, bedeutet dies, dass entweder ein Beweis oder eine Widerlegung dafür existiert, dass die Vorschrift immer im Zyklus 4, 2, 1, 4, 2, 1 ... endet (oder dass die Unbeweisbarkeit bewiesen wird; ich bezweifle, dass sogar letzteres unmöglich ist). Egal welcher Beweis, dieser erfordert immer endlich viele Schritte, kann also in endlicher Zeit erbracht und geprüft werden. Anschließend - d.h. nach endlicher Zeit - sind sich die Mathematiker demnach über die Lösung einig. Im Gegensatz dazu werden sich die Physiker nie über die Lösung des Messproblems einig sein, selbst wenn eine solche vorliegen würde. -- Ende der Ironie -- |
AW: Axiome der Quantenmechanik - orthodoxe Interpretation
Zitat:
BTW: In den letzten Jahren gab es scheinbar einige interessante und heiß diskutierte Messungen zum Thema Wigners Freund. |
AW: Axiome der Quantenmechanik - orthodoxe Interpretation
Zitat:
Die unlösbaren Probleme der Mathematik hingegen liegen ein wenig tiefer. Die Riemann-Vermutung ist hier das Paradebeispiel. Es geht darum, dass die Primzahlen zufällig verteilt sind, bzw. genau solche Eigenschaften haben, als wären sie zufällig verteilt. Aber die Mathematik hat keine zuverlässigen Schlussweisen, um Zufall beweisen zu können, oder gar mit Zufall-basierten Argumenten sauber schliessen zu können. Solche typischen "letztes Wort" Argumente wie bei Cantor-artigen Diagonalisierungen sind im Kontext von Wahrscheinlichkeiten schlicht "ein Fehler". Diese Art "Fehler" hat viele Namen, nenne es Overfitting, p-Hacking, oder ... Und normale menschliche Intuition ist einfach unvorstellbar schlecht in Bezug auf subtile Effekte, die bei "leicht falsch" verwendeten Wahrscheinlichkeiten auftreten "können". |
AW: Axiome der Quantenmechanik - orthodoxe Interpretation
Zitat:
Peter hat recht, weil
Zitat:
Zitat:
Zitat:
|
AW: Axiome der Quantenmechanik - orthodoxe Interpretation
Eigentlich war meine Aussage eher spaßig zu verstehen;-)
Zitat:
Zitat:
Das Messproblem ist eventuell auf ein rein mathematisches Problem zurückzuführen. Schlimmstenfalls bleibt es in Teilen metaphysisches Problem. |
AW: Axiome der Quantenmechanik - orthodoxe Interpretation
Zitat:
Das Hauptproblem, aus meiner Sicht, ist wohl der weit verbreitete Glaube an die Wellenfunktion (und die zeitabhängige Schrödinger-Gleichung) als dem Dreh- und Angelpunkt der Quantentheorie. Die Schrödiger-Gleichung gaukelt eine kontinuierliche und deterministische Entwicklung vor, wo doch das Sprunghafte und Zufällige zum Markenkern der Quantenphysik gehören. Im Heisenberg-Bild spielt die Wellenfunktiongar keine Rolle, und es bringt den statistischen Charakter der Theorie besser zum Ausdruck. |
AW: Axiome der Quantenmechanik - orthodoxe Interpretation
Zitat:
Zitat:
Zitat:
Zitat:
|
AW: Axiome der Quantenmechanik - orthodoxe Interpretation
Zitat:
Zitat:
Zitat:
|
AW: Axiome der Quantenmechanik - orthodoxe Interpretation
Zitat:
Aber jeder muss damit leben, dass die Schrödingergleichung eine kontinuierliche und deterministische Entwicklung ist. Daran kommt niemand vorbei. Zitat:
Es ging mir aber um deine Aussage der Sprunghaftigkeit. Wenn du nämlich genauer nachdenkst, dann stellst du fest, dass der Experimentalphysiker nie diesen Sprung real beobachtet, und dass 99% der Theoretiker diesen Sprung ebenfalls nie betrachten (sie betrachten Wahrscheinlichkeiten). Darüberhinaus wissen wir, dass es sehr einfache Beispiele gibt, die ohne Sprung (Kollaps) deutlich einfacher zu modellieren sind als mit (weil die Idee des trivialen Kollapses nicht nur ein rein intellektuelles Problem darstellt sondern praktisch zu falschen Vorhersagen führt). Erkläre doch spaßeshalber mal die Spuren in der Nebelkammer unter Nutzung des Kollapses. Zitat:
|
AW: Axiome der Quantenmechanik - orthodoxe Interpretation
Zitat:
Zitat:
Zitat:
|
| Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:30 Uhr. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
ScienceUp - Dr. Günter Sturm