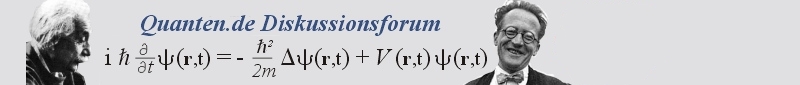
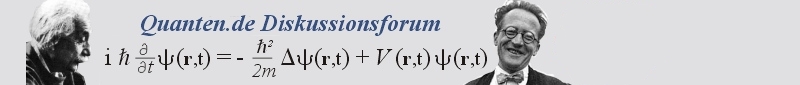 |
|
|||||||
| Wissenschaftstheorie und Interpretationen der Physik Runder Tisch für Physiker, Erkenntnis- und Wissenschaftstheoretiker |
 |
|
|
Themen-Optionen | Ansicht |
|
#21
|
||||
|
||||
|
Zitat:
Zitat:
Zitat:
Zitat:
Aus dem Bisherigen sehe ich nicht, dass es Fortschritte gibt, die zur Beweisbarkeit einer der Interpretation führen könnten. Aus deinen Ausführungen erkenne ich das zumindest nicht.
__________________
Der Verstand schafft die Wahrheit nicht, sondern er findet sie vor - Aurelius Augustinus |
|
#22
|
||||
|
||||
|
Natürlich trägt die Dekohärenz maßgeblich zum Verständnis des Messprozesses bei; sie erklärt mittels der Schrödingergleichung, welche makroskopisch zulässigen Zeiger-Zustände entstehen können.
Beweisbarkeit kannst du von keiner physikalischen Theorie erwarten, lediglich von ihrem mathematischen Kern. Es geht um Plausibilität; das war schon bei Newton vs. Kepler (Epizyklen) der Fall.
__________________
Niels Bohr brainwashed a whole generation of theorists into thinking that the job (interpreting quantum theory) was done 50 years ago. Ge?ndert von TomS (23.06.21 um 20:56 Uhr) |
|
#23
|
|||
|
|||
|
Zitat:
Hier wird Schlosshauer zitiert: We have argued that, within the standard interpretation of quantum mechanics, decoherence cannot solve the problem of definite outcomes in quantum measurement Nach meiner Auffassung erklärt das Dekohärenzkonzept das Zustandekommen quasi-klassischen Verhaltens. Ich sehe nicht, dass Dekohärenz eine der Interpretationen der QM stützt. Denn diese scheiden sich am Verständnis des Kollapses. Wenn du das anders siehst, würde ich dich um Referenzen bitten.
__________________
Der Verstand schafft die Wahrheit nicht, sondern er findet sie vor - Aurelius Augustinus |
|
#24
|
||||
|
||||
|
Zitat:
Nur um den Kollaps? Nein, das ist zu eng gefasst. Zum einen umfasst das Messproblem mehrere Teilprobleme: 1) welche Messergebnisse können auftreten? 2) wann, warum, mit welcher Wahrscheinlichkeit ... tritt ein konkretes Messergebnis auf? 3) wie wird das System während und nach der Messung beschrieben? Anders gesprochen, zu begründen sind die Postulate 1) Eigenwerte a als mögliche Messwerte 2) Bornsche Regel p(a) = <ψ|a><a|ψ> 3) von Neumannschen Projektionspostulat d.h. Kollaps |ψ> → |a><a|ψ> Die Dekohärenz besagt: 1) der spezifische Hamiltonoperator des Messgerätes selektiert die möglichen Zeiger-Zustände und Messwerte 2) die Norm je Komponente (Unterraum) liefert die Wahrscheinlichkeit 3) das Projektionspostulat wird zunächst weder postuliert oder abgeleitet noch ausgeschlossen Damit löst die Dekohärenz den Punkt (1). Sie liefert zusammen mit Gleason's Theorem die eindeutige und phänomenologisch zutreffende mathematische Regel zur Berechnung der Wahrscheinlichkeiten in (2) - bzw. eine geeignete Erweiterung - jedoch keine Begründung, warum überhaupt Wahrscheinlichkeiten auftreten. Außerdem lässt sie einerseits das Kollapspostulat zu, andererseits erlaubt sie auch den Verzicht darauf; im ersten Fall liefert sie wie bei (2) die Unterräume, auf die zu projizieren ist und motiviert zusammen mit (1) die Form von (3); im zweiten Fall löst sie nach Meinung von Zeh, Carroll, Wallace et al. das Problem, warum man von einem epistemischen d.h. lediglich wahrgenommenen Kollaps ausgehen kann, obwohl tatsächlich kein ontischer Kollaps stattfindet. Die Dekohärenz trägt demnach mittels des selben Formalismus in unterschiedlicher Weise zu verschiedenen Interpretationen bei. Es ist eine Frage der Interpretation, welchen Beitrag wir als natürlicher oder kohärenter empfinden. In den meisten Fällen löst die Dekohärenz jedoch einen Teil der Probleme - Ausnahme s.u. Insofern Zustimmung zu diesem Statement We have argued that, within the standard interpretation of quantum mechanics, decoherence cannot solve the problem of definite outcomes in quantum measurement. bzgl. eines Teilproblems im Rahmen einer speziellen Interpretation. Auch Zeh betont mehrfach, dass die Dekohärenz das Messproblem nicht vollständig löst, in Teilen jedoch zu einer Lösung maßgebliche Beiträge liefert. (soweit ich mich erinnere bleibt Schlossauer bzgl. der Interpretationen neutral) Eine mögliche Lesart ist also, dass die Dekohärenz zur Erklärung beiträgt, warum der Kollaps verzichtbar ist. Das umfasst zwei Aspekte: der "ontische" Kollaps ist sicher verzichtbar - siehe unten; ein lediglich "epistemischer" Kollaps wird zumindest teilweise erklärt (Zeh, Carroll, Wallace et al.). Zitat:
Ein explizites Beispiel ist das Mott-Problem, d.h. die Entstehung der Tröpfchenspuren in einer Blasenkammer: https://en.wikipedia.org/wiki/Mott_problem Wenn man die Wechselwirkungen des Elementarteilchens mit den Atomen und deren Ionisation als wiederholte Ortsmessung auffasst, dann fordert von Neumann einen Kollaps in einen Ortseigenzustand. Dieser ist bzgl. des Impulses isotrop, d.h. als Ergebnis folgt keine geradlinige Spur sondern ein isotroper Random Walk. In der o.g. Formulierung nach von Neumanns ist (1) demnach explizit falsch. Mott (1929!) löst das Problem explizit ohne Kollaps. Er berechnet Korrelationen, d.h. letztlich bedingte Wahrscheinlichkeiten P(z | x, y), d.h. die Wsk. für z unter den Annahme x und y. Im Ergebnis ist die Wahrscheinlichkeit für mehrere nicht auf einer Linie liegende Tröpfchen sehr nahe Null. Heisenberg hat wohl in Richtung von "weak measurements" gedacht und die o.g. Kollapsregel entsprechend modifiziert (ich habe keinen Zugriff auf das Paper). Es sollte darauf hinauslaufen, dass lediglich auf einen Unterraum statt auf einen Ortseigenzustand projiziert wird, dieser Unterraum bzgl. des Impulses anisotrop bleibt und somit eine geradlinige Spur resultiert. Dies hat den Schönheitsfehler, dass die Vorhersagbarkeit leidet, da man unter Verwendung geeigneter Unterräume lediglich ex post eine Erklärung erhält, während Mott ohne weitere Annahmen vorgeht. Anyway, das Mott-Problem ist ein Beispiel, das üblicherweise als Argument für den Kollaps im Falle aufeinanderfolgender Messungen am selben System angeführt wird, das jedoch in der Tat gegen einen Kollaps verwendet werden kann. Die Argumentation von Mott kommt natürlich ohne Dekohärenz aus. Neben der MWI kommen insbs. die Consistent Histories sowie die Ensemble Interpretationen ohne Kollaps aus. Ballantine hat letztere maßgeblich entwickelt und zeigt anhand weiterer Beispiele, wie u.a. auch der Quanten-Zeno-Effekt gegen den Kollaps interpretiert werden kann (wiederum habe ich keinen Zugriff auf das Paper). Wenn man also akzeptiert, dass der Kollaps als mathematische Regel nicht notwendig ist, um korrekte Messwerte und Wahrscheinlichkeiten zu berechnen, dann bleibt darüberhinaus die Frage, ob der Kollaps im ontischen Sinne ebenfalls verzichtbar ist (er wäre dann jedoch logisch inkonsistent). Dabei lautet die Argumentation der VWI, ausgehend von der Dekohärenz, dass die durch die environment-induced superselction (einselection, Zurek) ausgezeichneten Zweige genau die Eigenschaften haben, die man für einen "epistemischen" Kollaps benötigt. Im Falle der Nebelkammer würde die Dekohärenz die in der Projektion zu verwendende Unterräume liefern. D.h. ich kann entweder a) die Dekohärenz nutzen, um die Unterräume zu berechnen, auf die ich im Zuge eines Kollapses projiziere, oder b) nicht projizieren In beiden Fällen erhalte ich die selben Beobachtungen. (betrachte zwei Wellenpakete - klassisches Licht - die sich in entgegengesetzter Richtung auseinander bewegen; ob du als Beobachter eines Wellenpaketes das andere wegpostulierst oder seine Existenz akzeptierst läuft bzgl. der Phänomenologie auf's selbe raus) Die Aussage der MWI lautet also im wesentlichen, dass sich für die Quantenmechanik ohne (1) bis (3) sowie unter Einbeziehung der Dekohärenz ein axiomatisch einfacheres und insgs. schlüssigeres Bild ergibt, als für die Quantenmechanik mit (1) und (2); dem kann man zumindest in soweit folgen, als man schlecht Postulate wie (1) oder (2) ad hoc einführen kann, wenn man erst mittels komplizierter Berechnung die Entitäten erhält, die in (1) oder (2) zu verwenden sind. Die Dekohärenz verkompliziert die Argumentation an dieser Stelle maßgeblich - weil sie einen Teil der Probleme löst (klingt komisch, ist aber so). Einige Dinge sollten klar sein: der Kollaps ist in praktisch jeder Form verzichtbar; er verbleibt lediglich als praktische Rechenregel, deren Anwendbarkeit aber je Einzelfall zu prüfen ist; die Dekohärenz sowie andere Effekte liefern dafür überzeugende Argumente; in einigen Fällen verkompliziert der Kollaps die Argumentation (nach Ballantine wird sie sogar inkonsistent oder falsch); einige nicht-ontische sowie die MWI als ontische Interpretation kommen explizit ohne Kollaps aus; keine Interpretation, die die Dekohärenz ignoriert, liefert einen Beitrag zu einer echten Erklärung des Messproblems; jeder Versuch einer Kollapsinterpretation erscheint heute doch sehr fragwürdig; jeder Erklärungsversuch, der die hier diskutieren Punkte nicht berücksichtigt, kann nicht ernstgenommen werden.
__________________
Niels Bohr brainwashed a whole generation of theorists into thinking that the job (interpreting quantum theory) was done 50 years ago. Ge?ndert von TomS (24.06.21 um 15:16 Uhr) |
|
#25
|
||||
|
||||
|
Hier ein kurzer Artikel zu Mott‘s Arbeit:
https://arxiv.org/abs/1209.2665 Emergence of classical trajectories in quantum systems: the cloud chamber problem in the analysis of Mott (1929) We analyze the paper "The wave mechanics of α-ray tracks" (Mott, 1929), published in 1929 by N.F. Mott. In particular, we discuss the theoretical context in which the paper appeared and give a detailed account of the approach used by the author and the main result attained. Moreover, we comment on the relevance of the work not only as far as foundations of Quantum Mechanics are concerned but also as the earliest pioneering contribution in decoherence theory. Mott betrachtet ein abgeschlossenes Quantensystem, das aus einem Alphateilchen sowie den Atomen der Nebelkammer besteht. Er führt keinen Beobachter ein, er verwendet weder Heisenberg-Schnitt zwischen Quantensystem (Alphateilchen) und Messgerät (Nebelkammer) noch einen Kollaps a la von Neumann. Mott modelliert das „Messgerät“ explizit quantenmechanisch, im Gegensatz zu Bohrs Überzeugung, dass dies nicht möglich sei. Letztlich verzichtet er damit auf all die unnötigen Zutaten, die leider über Jahrzehnte als integrale Bestandteile und vermeintliche Rätsel der Quantenmechanik angesehen wurden – und heute noch werden. Der Artikel ist absolut lesenswert. Er vergleicht den expliziten, quantitativen und recht offensichtlichen Ansatz nach Mott ohne Kollaps mit den teilweise nur qualitativen Argumenten Heisenbergs mit Kollaps. Das Ergebnis – der Kollaps sei in seiner einfachen Form explizit falsch, in einer erweiterten Form weiterhin nicht präzise formuliert und nach der Lösung Mott’s ohnehin überflüssig – ist offensichtlich. Letztlich kann dieses Modell als sehr einfache Vorstufe zu Modellen für die Dekohärenz angesehen werden.
__________________
Niels Bohr brainwashed a whole generation of theorists into thinking that the job (interpreting quantum theory) was done 50 years ago. Ge?ndert von TomS (24.06.21 um 18:19 Uhr) |
|
#26
|
||||
|
||||
|
Hier findest du eine Erklärung auf Basis von „weak measurements“ und einem entsprechenden modifizierten Kollapspostulat. Ob das mathematisch funktioniert wird nie vorgerechnet, die einfache Lösung von Mott leider nicht zur Kenntnis genommen:
https://physics.stackexchange.com/qu...ntum-mechanics
__________________
Niels Bohr brainwashed a whole generation of theorists into thinking that the job (interpreting quantum theory) was done 50 years ago. |
|
#27
|
|||
|
|||
|
Wo ich auch nachschaue, geht es beim Messproblem um die Frage ob und wie der Kollaps der Wellenfunktion stattfindet. Und genau diese Frage löst die Dekohärenz nicht, was deine Aussage "das Projektionspostulat wird zunächst weder postuliert oder abgeleitet noch ausgeschlossen" bestätigt.
Am Kollaps und insbesondere an der Frage ob es ihn gibt oder nicht scheiden sich die Interpretationen, zumindest VWI vs. Kopenhagen. Ich erkenne in deinen Ausführungen nicht, welche Erkenntnisse der letzten Jahrzehnte konkret einer Lösung dieser Frage näher kommen. Darum ging es. Du erwähnst "Meinungen" dieser und jener Experten auf diesem Gebiet. Auch Zeilinger, den ich schon einige male erwähnt habe, hat seine Meinung. Dagegen ist ja nicht das Geringste einzuwenden. Aber wir sind uns sicherlich einig, dass Meinungen die adressierte Frage nicht lösen. Angesichts deiner investierten Zeit und Mühe, wofür ich mich bedanke, beschleicht mich zunehmend ein schlechtes Gewissen.
__________________
Der Verstand schafft die Wahrheit nicht, sondern er findet sie vor - Aurelius Augustinus |
|
#28
|
||||
|
||||
|
Hallo Timm,
ich fürchte, du suchst zu viel und schaust auch an den falschen Stellen nach. Ich bestreite keineswegs, dass das Messproblem häufig um den Kollaps herum aufgezäumt wird; ich bestreite lediglich, dass das sinnvoll ist (und ja, ich behaupte, dass du zu dem Thema sicher viel Quatsch finden wirst). Anstatt sich mit dem Kollaps rumzuplagen, führt man ihn erst gar nicht ein. Er ist überflüssig bis nutzlos, führt zu vermeidbaren Problemen und ist in der oft zitierten einfachen Fassung beweisbar falsch. Man kommt einer Lösung des Messproblems am besten dadurch näher, dass man von vorneherein auf ihn verzichtet. Viele moderne Interpretationen sind sich diesbzgl. einig. Wenn man eine ontische Interpretation anstrebt, dann kann man sich mit einem rein epistemischen Kollaps befassen. Da du die MWI nicht magst, zu der das wohl zwangsläufig führt, musst du diesen Schritt aber nicht mitgehen. Zitat:
 Lies dir den oben verlinkten Artikel durch. Mott‘s Rechnung ohne Kollaps ist präzise und klar. Außer der Schrödingergleichung sowie einer minimalen stochastischen Interpretationen mit der Bornschen Regel (2) wird nichts weiter benötigt. Noch einfacher geht’s nicht. Was bleibt dann deiner Meinung nach für diesen konkreten Fall noch als „Messproblem“ übrig? Zitat:
Zitat:
EDIT: eine Erkenntnis ist, sich besser nicht mit Kopenhagen zu befassen … Kannst du deine Frage(n) nochmal präzisieren?
__________________
Niels Bohr brainwashed a whole generation of theorists into thinking that the job (interpreting quantum theory) was done 50 years ago. Ge?ndert von TomS (24.06.21 um 20:19 Uhr) |
|
#29
|
||||
|
||||
|
Einen guten Startpunkt bietet m.M.n. das Maudlin-Trilemma.
Maudlin formuliert das Messproblem unabhängig von einem historischen Kontext oder einer speziellen Interpretation; insbs. Kopenhagen spielt bei ihm eine untergeordnete Rolle. Sein unmittelbares Ziel besteht darin, Interpretationen nach ihren Lösungsstrategien für das Messproblem zu kategorisieren. Maudlin zeigt, dass die folgenden drei Aussagen zusammengenommen inkonsistent sind: 1) Der Zustandsvektor beschreibt das System vollständig 2) Der Zustandsvektor folgt immer einer linearen Zeitentwicklung 3) Messungen haben immer ein definiertes Ergebnis (im Sinne einer definierten Eigenschaft bzgl. einer Observablen) Theorien mit verborgenen Variablen wie die Bohmsche Mechanik lehnen (1) ab. Die Standard-Quantenmechanik und andere Kollaps-Theorien lehnen (2) ab. Beide führen neben dem Zustandsvektor und der unitären Zeitentwicklung neue Physik ein, erstere verborgenen Variablen, letztere einen Kollaps. Everett hält an (1 - 2) fest und lehnt (3). Dies führt nicht zu einem einzigen, definierten Ergebnis; stattdessen sind alle quantenmechanisch zulässigen Messergebnisse in je einer Komponente, des Zustandsvektors repräsentiert. http://www.psiquadrat.de/downloads/maudlin95.pdf Der Artikel ist lesenswert, insbs. bzgl. der Problemanalyse. Die Bewertung der Lösungsansätze - bereits im Abstract - halte ich dagegen für voreilig: Ansätze wie Consistent Histories sowie die Ensemble-Interpretation kommen zu kurz; bei verborgenen Variablen als auch alternativen Kollaps-Theorien sehe ich kein Potenzial, diese hin zu Quantenfeldtheorien zu verallgemeinern; die knappe Analyse der Everettschen Quantenmechanik führt zwar tatsächlich zum Kern des Problems, Lösungsansätze werden jedoch nicht betrachtet.
__________________
Niels Bohr brainwashed a whole generation of theorists into thinking that the job (interpreting quantum theory) was done 50 years ago. Ge?ndert von TomS (25.06.21 um 07:20 Uhr) |
|
#30
|
|||
|
|||
|
Zitat:
... ob ich's wieder gutmachen kann, weiß ich nicht. Ich kann dich lediglich einladen, dich an der Diskussion zum Thema Are there signs that any Quantum Interpretation can be proved? zu beteiligen. Du hast offenbar gewichtige Argumente, bringe sie dort ein! Wenn es generell um die Interpretationen der QM geht, driften Experten schnell auseinander und jeder hat seine Argumente. Bei diesem Thema geht es jedoch nur darum, wie man zweifellos erzielte Fortschritte wertet.
__________________
Der Verstand schafft die Wahrheit nicht, sondern er findet sie vor - Aurelius Augustinus |
 |
| Lesezeichen |
|
|